Im Jahr 2016 richtete die DGNB erstmals ihre Sustainability Challenge aus. Was im Kleinen begann, ist heute ein viel beachteter Nachhaltigkeitswettbewerb mit jährlich zahlreichen Bewerbungen. Seit 2019 vergibt der Non-Profit-Verein diesen Innovationspreis in den drei Kategorien "Innovation", "Start-up" und "Forschung".
Gewinner und Finalisten 2025
Co-reactive - Gewinner

Co-reactive entwickelt eine Mineralisierungstechnologie, um CO₂ dauerhaft in Zusatz- und Ersatzstoffen für Zement zu binden (SCM). Das verwendete CO₂ stammt aus Industrieprozessen und biogenen Quellen. Die SCMs verbessern nicht nur den Carbon-Fußabdruck von Betonprodukten, sondern auch deren Materialeigenschaften wie Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Reaktivität.
NatStruct AG

NatStruct bringt Nachhaltigkeit und Innovation in die Naturfaserindustrie, indem es landwirtschaftliche Abfälle in hochwertige Naturfasern verwandelt. Mit seiner GROW-Tech-Fasertrennungstechnologie unterstützt das Start-up die Kreislaufwirtschaft. So entstehen zukunftsfähige Lösungen für die Bau-, Automobil-, Möbel- und Textilindustrie.
re-green

re-green saniert Gewerbeimmobilien ESG-konform – ohne Kosten für Eigentümer. Durch Mieterstromverträge werden PV-Anlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur finanziert. Das Start-up übernimmt Planung, Bau und Betrieb. Ziel: Werterhalt, CO₂-Einsparung und attraktive, zukunftsfähige Immobilien für Eigentümer und Nutzer.
GLAPOR Urban Mining Bodenplatte UMB1 - Gewinner

Die CO₂-reduzierte und kreislauffähige GLAPOR Urban Mining Bodenplatte UMB1 vereint Bodenplatte und Wärmedämmung. Sie besteht aus aufgeschäumtem Glas aus dem Altglas-Recycling und ist druckfest, formstabil sowie wasserbeständig. Dadurch eignet sie sich für Bauprojekte vom Wohnhaus bis zum Gewerbebau.
HUMID-Module

Die kreislauffähigen HUMID-Module der ArgillaTherm GmbH kühlen, heizen und regulieren die Luftfeuchtigkeit für ein gesundes und behagliches Raumklima. Sie bestehen aus Tonmineralen, Lehm, Ziegelmehl und Naturfasermaterial. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen können mit den Modulen betriebsbedingte Gebäude-Emissionen und Kosten eingespart werden.
Instant BioBitumen

Das Zwei-Komponenten-Produkt Instant BioBitumen der B2Square GmbH bindet pro Tonne ca. 1,5 Tonnen CO₂. Die niedrigen Prozess- und Verarbeitungstemperaturen im Vergleich zu herkömmlichem Bitumen erhöhen die Sicherheit in Handhabung, Lagerung und Transport. Basis für das Instant BioBitumen sind Cashewnussschalen und eine trockene Mineral-Vormischung.
"Smart Circular Bridge" in Ulm: Bio-basierte Brücke als Musikinstrument - Gewinner

Im Rahmen des EU-geförderten Verbundprojektes wurde in Ulm die erste befahrbare Brücke aus Flachsfasern und bio-basiertem Polyesterharz errichtet. Die kreislauffähige Brücke in Leichtbauweise ist mit Sensoren ausgestattet, die Daten für die Materialforschung liefern und sie gleichzeitig über eine Audio-WebApp als interaktives Musikinstrument erlebbar machen.
LEGO. Stranggepresste Hochlochlehmbausteine für Innenwände als Substitution für Rigips-Wände - Gewinner Publikumspreis

Das Forschungsprojekt untersucht den Ersatz von Gipsbauplatten durch stranggepresste Lehmsteine, da Lehm eine bessere Kreislauffähigkeit und klimatische Vorteile bietet. Dabei werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, um einen optimierten Lehmstein zu entwickeln. Die Ergebnisse werden in einem Leitfaden veröffentlicht und Open Access zugänglich gemacht.
(De-) Montierbarkeit und statische Performance von Holzverbindungen im Hinblick auf Re-Use und Zirkuläres Bauen

Das Projekt untersucht die Re-Use-Tauglichkeit von Holzbauverbindungen. Drei Fachwerke werden zyklisch belastet, zerlegt, erneut montiert und bis zum strukturellen Versagen getestet. Die Ergebnisse sollen Empfehlungen liefern, welche Verbindungen besonders gut für eine Wiederverwendung geeignet sind.
Hoffnungshaus: Impact mit integrativem Wohnen im nachhaltigen, bezahlbaren Wohnraum - Gewinner

In den Hoffnungshäusern leben Geflüchtete und Einheimische, sozial benachteiligte Personen und Menschen, die mitten im Leben stehen, unter einem Dach. Das integrative Wohnkonzept fördert Teilhabe, Sprachkompetenz und Demokratieverständnis. Die in Holzbauweise errichteten Gebäude tragen mit Konzepten wie passiver Verschattung, Dachbegrünung und Regenwasserspeicherung zudem zu Klimaanpassung und Biodiversität bei.
Nachhaltigkeitsbewertung – Einfluss der Zirkularität auf die CO2-Bilanz eines Bauteils - Gewinner

Das studentische Projekt analysierte den Zusammenhang von Zirkularität und CO₂-Bilanz im Bauwesen anhand des neuen DGNB Zirkularitätsindex. Die Analyse zeigt eine negative Korrelation zur CO₂-Bilanz und liefert einen rechentechnisch fundierten Vergleich zwischen Ökobilanz und Zirkularität auf Bauteilebene.
Windturm 2.0 - Gewinner

Im Projekt Windturm 2.0 wurde ein Prototyp zur passiven Kühlung öffentlicher Räume entwickelt – inspiriert von historischen Windtürmen des westasiatischen Kulturraums. Ziel war es, Orte der Abkühlung und Begegnung im urbanen Raum zu schaffen. Untersucht wurden bauphysikalische, soziale und gesundheitliche Effekte sowie modulare Ansätze für die Baupraxis.
Gewinner und Finalisten 2024
Hanffaser Geiseltal eG - Gewinner

Die genossenschaftlich organisierte Hanffaser Geiseltal eG hat sich 2022 mit dem Ziel gegründet, eine Produktionsstätte für Bau- und Dämmstoffe aus Hanffasern zu etablieren, um die Rohstoffwende voranzutreiben. Das Start-up aus dem Saalekreis kauft Hanfstroh von Landwirten aus der Region und verarbeitet es in einer Faseraufschlussanlage zu Baustoffen, Dämmmaterialien und Halbzeug, das beispielsweise als Zuschlag für Lehmprodukte zum Einsatz kommt.
ecoLocked GmbH

Mit den Betonzusatzstoffen aus Biokohle der 2021 gegründeten ecoLocked GmbH werden Gebäude zu Kohlenstoffsenken. CO2 wird dauerhaft im Baumaterial gespeichert, der Bedarf an fossilen Rohstoffen wird reduziert und die Materialeigenschaften werden hinsichtlich Isolierung, Haltbarkeit und Herstellungszeit verbessert. Mit Hilfe ihrer datengesteuerten Produktentwicklungsplattform kann das Start-up zudem Betonrezepturen hinsichtlich Klimaverträglichkeit und Leistung anpassen.
Optocycle GmbH

Das 2022 gegründete Tübinger Start-up Optocycle hat ein KI-gestütztes System entwickelt, das durch den Einsatz optischer Sensoren eine präzise Identifizierung von mineralischen Baumischabfällen, Boden, aber auch Rezyklaten direkt vor Ort ermöglicht. Das System erlaubt Analysen, die dabei unterstützen, Abfallströme besser zu verstehen und Optimierungspotentiale aufzudecken. Dadurch wird eine effiziente Wieder- und Weiterverwendung möglich.
Conclay - Gewinner

Conclay, ein Produkt der Firma Kimm aus dem nordhessischen Wabern-Udenborn, ist der erste formgepresste, tragende, industriell hergestellte Lehmplanstein in Deutschland. Ein innovatives Herstellungsverfahren ermöglicht es, großformatige Lehmsteine in so hoher Qualität zu erstellen, dass sie vergleichbar mit Wandbaustoffen wie Ziegel oder Kalksandstein verbaut werden können. Die Produktion findet in vorhandenen Industrieanlagen statt und verwendet sekundäre Lehme aus Baugruben und Kiestagesbaustätten.
karuun®

Die Innovation karuun® macht sich die Kapillarwirkung von Rattan zunutze, einer Kletterpflanze, die zum Erhalt der Regenwälder beiträgt. Über die Kapillargefäße in den Rattanstangen wird das Material u.a. mit Farbpigmenten behandelt. Anschließend werden die Stangen zugeschnitten und zu Blöcken verpresst. Das Material dient als Alternative zu bestimmten Kunststoffen und Holz.
Roofit.Solar

Die Firma Roofit Solar aus Beetzendorf in Sachsen-Anhalt bietet eine komplette, gebäudeintegrierte 2-in-1 Solardachlösung. Kombiniert wird ein witterungsfestes Metalldach in traditioneller nordischer Doppelstehfalz-Optik mit Solartechnologie. Dafür wird ein innovativer Verbundwerkstoff aus Stahlblech, monokristalliner PV-Folie und Temperglas Beschichtung verwendet. Das Ergebnis ist ein ästhetisches, leistungsgenerierendes Metalldach.
circularWOOD - Gewinner
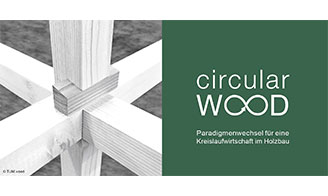
Das Forschungsprojekt circularWOOD der Technischen Universität München und der Hochschule Luzern hat die Umsetzung zirkulärer Prinzipien im Holzbau untersucht. Erfasst wurden der Stand der Forschung, Forschungslücken und Umsetzungserfahrungen aus der DACH-Region. Außerdem wurden praxisnahe Handlungsempfehlungen entwickelt.
Fertigteil 2.0

Im Forschungsprojekt Fertigteil 2.0 der Technischen Universitäten Darmstadt und Braunschweig, THING TECHNOLOGIES sowie FARO Europe wird eine Strategie entwickelt, aus vorhandenen Betonkonstruktionen sogenannte Fertigteile 2.0 zu gewinnen. Dafür werden Betonteile aus Abrissgebäuden bearbeitet und für neue Planungsprozesse verfügbar gemacht.
PointClouds2LCA

Im Forschungsprojekt PointClouds2LCA der Technischen Universität München wird eine Methode entwickelt, mit der künftig kostengünstig und zeiteffizient bereits in frühen Planungsphasen verschiedene Sanierungsszenarien für Bestandsgebäude hinsichtlich ihrer Ökobilanz abgeschätzt werden sollen. Dafür nutzt das Projekt sogenannte Punktwolken.
Die wilde Klimawand - Gewinner und Gewinner des Publikumspreises

"Die wilde Klimawand“ ist ein Grünfassadensystem mit heimischen Wildstauden, Kräutern, Gräsern und Strukturen sowie darauf abgestimmten integrierten Brut- und Nistplätzen für Wildbienen, Vögel und Fledermäuse. Ziel ist, die Biodiversität und ein angenehmes Stadtklima in urbanen, hochverdichteten Räumen zu fördern. Beteiligt sind das Fraunhofer IBP, die Universität Stuttgart sowie Helix Pflanzensysteme.
karuun®

Die Innovation karuun® macht sich die Kapillarwirkung von Rattan zunutze, einer Kletterpflanze, die zum Erhalt der Regenwälder beiträgt. Über die Kapillargefäße in den Rattanstangen wird das Material u.a. mit Farbpigmenten behandelt. Anschließend werden die Stangen zugeschnitten und zu Blöcken verpresst. Das Material dient als Alternative zu bestimmten Kunststoffen und Holz.
Trockenbauplatten aus Moorbiomasse

Die Trockenbauplatten werden aus so genannten Paludikulturen hergestellt. Diese landwirtschaftlich genutzten, im Winter geernteten Gräser wachsen auf rückvernässten Mooren und naturbelassenen Flächen. Tier- und Pflanzenarten, die hier einen Lebensraum finden, werden nicht beeinträchtigt. Durch die CO2-bindenden Eigenschaften rückvernässter Moore und das im Material gebundene CO2 sollen die Platten zum klimaneutralen Bauen beitragen.
Die Auswirkung von Fassadenbegrünung auf die Lebenszyklusanalyse eines Wohnquartiers unter Einbezug thermischer Simulation | Gewinner

Um eine Strategie zur optimalen Fassadenbegrünung zu ermitteln, vergleicht die Masterthesis von Bernadette Lang-Eurisch an der TU Darmstadt, mittels einer Lebenszyklusanalyse (LCA) und mikroklimatischer Analyse, die Umwelt- und mikroklimatischen Effekte urbaner Wohnquartiere in Deutschland. Mit den Ergebnissen können Planungs- und Designentscheidungen getroffen werden, welche den thermischen Komfort und die Umweltleistung beeinflussen.
Gewinner und Finalisten 2023
STRAMEN.TEC - Gewinner und Gewinner des Publikumspreises

Das Start-up STRAMEN.TEC hat ein Trockenbausystem ganz ohne Ständerwerk auf Basis des schnell nachwachsenden Rohstoffs Stroh entwickelt und auf den Markt gebracht. Das im Stroh enthaltene Lignin macht die Zugabe weiterer Bindemittel überflüssig. Die Wandmodule können wiederverwendet und am Ende ihrer Nutzungsdauer in den Produktionsprozess zurückgeführt werden.
aerogel-it - Finalist

Aerogel-it entwickelt Hochleistungsdämmstoffe aus Bioaerogelen oder Biomineralaerogelen, die bei hoher Wärmedämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen dünner und leichter sind. Die hochporösen Festkörper werden beispielsweise aus dem Pflanzenrohstoff Lignin hergestellt, speichern damit Kohlenstoff und sind wiederverwertbar.
The Colony - Finalist

The Colony ist ein Start-up, das Gemeinschaftsorte mit einem sozio-ökologischen Ansatz auf leerstehenden Flächen oder in ungenutzten Gebäuden schafft. In Vollholz-Modul-Haus-Siedlungen sollen Wohnen, Leben, Arbeiten und Unterhaltung auf bisher ungenutzten Sonderflächen zusammenkommen.
ecoHab - Gewinner

Das Unternehmen Smarter Habitat hat ein Baupaneel entwickelt, das aus expandiertem Industriemais als Isolationsmaterial und Naturfaserlaminaten besteht. Der Baustoff wird aus regionalen Rohstoffen hergestellt und stellt eine skalierbare Alternative zu CO2-intensiven Baustoffen im Trockenbau dar.
CARBOrefit - Gewinner Publikumspreis

Mit CARBOrefit hat das Unternehmen Carbocon ein Verfahren entwickelt, das den ressourceneffizienten Baustoff Carbonbeton nutzt, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Bestandsgebäuden und Brücken zu erhöhen. Der Baustoff ermöglicht die Ertüchtigung von Bauwerken, die mit konventionellen Maßnahmen nicht sanierbar wären.
TeamUp4Sustainability - Finalist
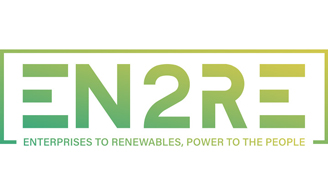
EN2RE bietet mit „Team-Up4Sustainability" eine digitale Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, die Sanierung ihrer Gebäudebestände mithilfe von Mitarbeiterbeteiligungen zu finanzieren. Damit kann notwendiges Eigenkapital beispielsweise für eine PV-Anlage bereitgestellt und die Transformation in Teamarbeit mit der Belegschaft beschleunigt werden.
Holz, Ziegel, Lehm | Pilotprojekt zu nachhaltigem Mietwohnungsbau - Gewinner

Ein Pilotprojekt zum nachhaltigen Mietwohnungsbau hat die TU Berlin mit ZRS Architekten, Bruno Fioretti Marquez, der Universität Stuttgart und der Technischen Universität Braunschweig gestartet. Am Beispiel von Holz-Lehm- und Ziegel-Holz-Gebäuden untersucht das Forschungsvorhaben robuste, kreislaufgerechte und technikreduzierte Bauweisen für den bezahlbaren Mietwohnungsbau.
Entwicklung eines Entkernungs- und Abbruchkosten Index für den Hochbau (EAKI) - Finalist

Die Bergische Universität Wuppertal hat einen Entkernungs- und Abbruchkosten-Index für den Hochbau entwickelt. Die Datenbank liefert Informationen zu den Kosten und Materialmengen, die bei einem potenziellen Rückbau entstehen. Damit steigert der Index die Kostensicherheit und ermöglicht eine bessere Risikobewertung von Rückbauprojekten.
NuKoS - Nutzung von Kohlenstoffdioxid in Schlacken aus Stahl- und Metallproduktion - Finalist

Das Forschungsprojekt NuKoS des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT nutzt ein Abfallprodukt der Stahlherstellung, die sogenannte Stahlwerkschlacke, für die Herstellung von Mauerwerksteinen. Damit werden konventionelle Binder mit hohem CO2-Fußabdruck ersetzt. In den Steinen wird über den Härtungsprozess zudem CO2 dauerhaft gebunden.
Entwicklung eines praxisgerechten Instruments zur Ökobilanzierung von Sanierungsmaßnahmen

Ein Student des Karlsruher Instituts für Technik (KIT) hat im Rahmen seiner Masterarbeit ein praxisgerechtes Instrument zur Ökobilanzierung von Sanierungsmaßnahmen bei Wohngebäuden entwickelt. Damit können die potenziellen Treibhausgasemissionen verschiedener Baumaßnahmen frühzeitig erkannt und Bauweisen optimiert werden.
HopfON - Baumaterialien aus den Abfällen der Hopfenernte

Unter dem Namen „HopfON" haben zwei Studierende der Technischen Universität München (TUM) aus Abfällen der Hopfenernte Akustik- und Wärmedämmplatten sowie Baupaneele für den Innenausbau entwickelt. Damit soll das Angebot kreislauffähiger Baustoffe aus lokalen Abfallprodukten ausgebaut und der ökologische Fußabdruck der Baubranche reduziert werden.
Gewinner und Finalisten 2022
mygreentop - Gewinner

Das 2020 gegründete Start-up mygreentop verspricht ein praktisches und kostengünstiges begrüntes Schrägdach sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden. Dafür entwickelte das Plettenberger Unternehmen die mygreentop Aufdachpflanzpfanne. Diese kann mit bereits vorhandenen Dachpfannen ausgetauscht oder als Aufsatz nachgerüstet werden.
alcemy GmbH - Finalist

Das Berliner Unternehmen alcemy bietet eine KI-gestützte Software zur prädiktiven Qualitätsaussteuerung bei der Herstellung von Zement und Beton an, wodurch der Klinkeranteil und somit auch der CO2-Fußabdruck reduziert werden kann. Die Software läuft sowohl im Zementwerk als auch im Fahrmischer, der zur Baustelle fährt und erhebt 24/7 Daten in Echtzeit, trifft Prognosen und greift, wenn möglich, in die Produktion ein.
TRIQBRIQ AG - Finalist

2021 gegründet, produziert und vertreibt die Stuttgarter TRIQBRIQ AG das Massivholz-Bausystem TRIQBRIQ. Die standardisierten Holzbausteine werden aus Schwach- und Schadholz hergestellt und können durch ein Dübel-Verbindungssystem schnell und ohne künstliche Verbindungsmittel gefertigt, verbaut und sortenrein rückgebaut sowie vollständig wiederverwendet werden.
HPS Home Power Solutions GmbH - Gewinner

picea von HPS ist der weltweit erste marktverfügbare Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Gebäude. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Solaranlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. picea ermöglicht ganzjährig eine CO2-freie Stromversorgung.
Madaster Germany GmbH - Finalist

Der digitale Gebäuderessourcenpass von Madaster dokumentiert die in einem Gebäude verbauten Materialien und Bauteile und ermöglicht so eine finanzielle und zirkuläre Bewertung sowie die Berechnung des CO2-Fußabdruckes auf Material- und Gebäudeebene. Hierzu werden Material- und Bauteilinformationen eines Gebäudes u.a. auf Basis von BIM-Modellen erfasst.
UNDKRAUSS Bauaktiengesellschaft - Finalist

MeshClimate von UNDKRAUSS und weiteren Partnern ist eine ultradünne, kreislauffähige und flexible Fußboden- und Deckenheizung bzw. -kühlung. Das System wird direkt auf dem Bestandsestrich verlegt. Die Wabenstruktur der Klimaplatte bietet ohne Wärmeverteilschicht eine vollflächige Heiz- bzw. Kühlleistung in allen Einbausituationen – ob Boden, Wand oder Decke.
Fairventures Worldwide gGmbH & Fairventures Social Forestry GmbH - Finalist

Fairventures Worldwide gGmbH und die Fairventures Social Forestry GmbH haben in Indonesien eine Leichtholzkonstruktion aus Sengon-Holz erprobt, einer besonders schnell und lokal wachsenden Baumart. Das Bausystem soll die Aufforstung gerodeter Urwaldflächen fördern und einen Beitrag zu CO2- Reduktion, Biodiversität und sozialer Gerechtigkeit leisten.
NEWood - a novel mycelium-based composite made from organic waste - Gewinner

Aus dem Karlsruher Projekt ist eine neue Klasse von biobasierten, ressourceneffizienten und CO2-negativen Materialien mit dem Namen "NEWood" hervorgegangen. Die Holzalternative wird aus verfügbaren organischen Abfällen entwickelt und unter Verwendung von Pilzmyzel als natürlichem Bindemittel hergestellt.
Kalkspeicher - Saisonaler Strom-Wärme-Speicher für Gebäude - Gewinner Publikumspreis

Im DLR-Projekt wird basierend auf der chemischen Reaktion von gebranntem Kalk eine Prototypanlage entwickelt und erstmalig im Feld demonstriert: Mit überschüssigem, erneuerbarem Strom wird gelöschter Kalk gebrannt, der die Energie über Monate verlustfrei speichern kann. Bei Kontakt mit Wasser wird die Energie wieder freigesetzt und kann zum Heizen genutzt werden.
SenseLab - Finalist

Für das multidisziplinäre Forschungsprojekt SenseLab der TU München werden biometrische Daten von Raumnutzerinnen und -nutzern erfasst und in Echtzeit verarbeitet. So kann die Wirkung einer Umgebung auf den Körper objektiv ermittelt werden. Langfristig ermöglicht dies, Energie- und Kosteneinsparungen durch dynamische, dezentrale und an individuelle Bedürfnisse angepasste Raumklima-Konzepte.
Solar Decathlon goes urban - Gewinner

Im Zuge des Wettbewerbs "Solar Decathlon" entwickelt das interdisziplinäre studentische Team levelup der TH Rosenheim ein Konzept für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden und deren Aufstockung in Holzmodulbauweise. Zudem baut das Team eine repräsentative, voll-funktionsfähige Wohneinheit im Maßstab 1:1. Für das Projekt werden ausschließlich rezyklierte und rezyklierbare Materialien verwendet.
Materialgeschichten - Gewinner
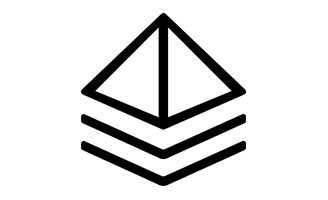
In dem Projekt von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar entsteht ein um- und rückbaufähiger Pavillon, der ausschließlich aus geborgenem Material sowie Materialspenden aus der urbanen Mine Weimars besteht. Dabei sollen nicht nur Hindernisse und Vorurteile des zirkulären Bauens untersucht, sondern auch die wiederverwendeten Bauteile innerhalb einer Ausstellung über Geschichten erfahrbar gemacht werden.
Gewinner und Finalisten 2021
Concular - Gewinner

Concular schließt täglich Materialkreisläufe von Gebäude zu Gebäude. Mit intelligenter Vermittlung, Ökobilanzierung und zirkulärer Lieferkette wird Wiederverwendung einfach, wirtschaftlich und messbar. Concular ist nicht nur eine Software - es ist die Wertschätzung für Material, Gebäude und Umwelt. Die Geschichten hinter den Materialien zu erzählen und damit neue Gebäude zu bereichern - das ist die Mission von Concular. Dabei werden Millionen Tonnen CO2, Abfall und Ressourcen eingespart.
carbonauten GmbH - Finalist
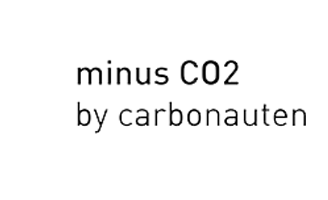
Baumaterialien, die CO2 speichern statt verursachen: Das ermöglicht die 2017 gegründete carbonauten GmbH. Das Start Up aus Giengen entwickelt Negative Emission Technology-Materialien, die aktiv CO2 reduzieren. Die Basis stellen Biokohlenstoffe aus Biomasseresten dar.
ecoworks GmbH - Finalist

Das 2018 gegründete Start-up ecoworks entwickelt ein ganzheitliches Sanierungssystem für die CO2-neutrale, serielle Sanierung von bestehenden Wohngebäuden. Der Umbau vor Ort soll zukünftig nicht länger als 2 Wochen dauern, um die Mieter so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die erste Serielle Sanierung mit 12 Wohnungen wurde 2021 erfolgreich in Hameln fertig gestellt.
Interface - CO2 als Ressource: Embodied Beauty™ - Gewinner

Der Bodenbelagshersteller Interface präsentiert mit seiner Kollektion „Embodied Beauty™" erstmals drei CO2-negative Teppichfliesen, die den CO2-Fußabdruck in Bauprojekten verringern können.
AMPEERS ENERGY - Mieterstrom & Quartiersmanagement - Finalist

AMPEERS ENERGY unterstützt dabei, die CO2 Reduktion von Immobilien in profitable Geschäftsmodelle umzuwandeln, indem der Eigentümer in die Lage versetzt wird, die sektorenübergreifende Energieoptimierung oder auch Mieterstrommodelle mit intelligenten Softwarelösungen sehr einfach und profitabel umzusetzen.
Terran - Generon - Finalist

Das ungarische Unternehmen Terran hat mit seinem Produkt „Generon" einen Dachziegel entwickelt, der die Schutzfunktion von Dachziegeln mit der Nutzung von Sonnenenergie vereint. Das Besondere: Die Photovoltaikzellen werden so in die Oberfläche der einzelnen Dachsteine integriert, dass sich diese Photovoltaik-Dachziegel optisch kaum von herkömmlichen Dachsteinen unterscheiden.
Urban Mining Index - Gewinner

Mit dem Urban Mining Index (UMI) haben die Forscherinnen und Forscher der Universität Wuppertal ein Planungsinstrument für zirkuläres Bauen entwickelt. Der UMI verfolgt das Ziel, Baustoffe in möglichst geschlossenen Kreisläufen zu führen und macht die Qualität der Nachnutzung von Wert- und Abfallstoffen in Gebäuden quantitativ messbar.
"Einfach Bauen" - Finalist
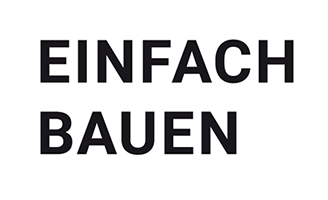
Wie kann Architektur so optimiert werden, dass es möglichst wenig Technik bedarf, um ein angenehmes Raumklima zu erzeugen? Diese Frage steht im Fokus der Forschung der Technischen Universität München. Ihr Ziel ist es, die Komplexität des Bauens zu reduzieren und Häuser zu entwerfen, die einfach zu bauen und einfach zu betreiben sind.
ge3TEX - Finalist

Im Rahmen des Forschungsprojektes ge3TEX der Frankfurt University of Applied Sciences wurden kreislauffähige Verbundmaterialien aus Textilien und Schäumen gleicher Werkstoffgruppen sowie die entsprechenden Herstellungsprozesse zum Ausschäumen von 3D-Textilien zu sortenreinen Bauteilen für die Gebäudehülle entwickelt.
Terra Vermelha

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Terra Vermelha" haben die Studierenden der Technischen Universität Berlin ein Konzept für eine nachhaltige Favela-Architektur entworfen. Der Fokus lag hierbei auf dem Einsatz von Holz und Lehm. Im Zuge ihres Projektes haben sie diese "lowtech" Baumethoden in den modernen Kontext übersetzt und eine hybride Holz-Lehm-Architektur entwickelt.
Gewinner und Finalisten 2020
Energie PLUS Concept GmbH - Gewinner

Ganze Siedlungen und Quartiere mit Wärme versorgen und das aus erneuerbaren Energien: das ist das Ziel der EPC. Hierfür entwickelt sie erneuerbare Energiekonzepte – meist unter Verwendung eines sogenannten Kalten Nahwärmenetzes in Kombination mit oberflächennahester Geothermie. Durch die Bündelung der Wärmeerzeugung und die serienmäßig einsetzbaren Wärmepumpen eignen sie sich für die Versorgung und Vermarktung ganzer Siedlungen.
Breeze Technologies - Finalist

Saubere Luft dank kleiner Sensoren und Künstlicher Intelligenz: das ist Breeze Technologies. Das Ziel des Start-ups aus Hamburg ist es, auf Basis hochauflösender Luftqualitäts- und Klimadaten sowie durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz, datengetriebene Entscheidungen zur Reduzierung der Luftverschmutzung zu finden, durchzuführen und zu überwachen.
Ricehouse -Finalist

Ricehouse, hier ist der Name Programm, denn das Start-up aus der Region Piemont verwendet organische Rückstände aus der Reisproduktion und entwickelt 100% natürliche Baumaterialien, die am Ende ihres Lebens in die Natur zurückkehren. Dafür schafft das Unternehmen kurze Lieferketten und ermöglicht eine optimierte Wirtschaftlichkeit vom Feld bis zur Baustelle.
interpanel – Die akustisch wirksame Klimaleuchte - Gewinner

Eine Lösung für alle raumklimatischen Bedürfnisse: Die Klimaleuchte sorgt für thermischen, akustischen und visuellen Komfort in einem. Die Innovation von interpanel ist eine modulare, akustisch wirksame licht-, heiz- und taupunktunabhängige Kühldecke. Smart gesteuert wird so eine gute Akustik, tageslichtnahe Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Temperatur gesichert.
Ecolift Hybrid-Hebeanlagen – der direkte Weg der Entwässerung - Finalist

Jedes Gebäude muss vor zurückdrückendem Abwasser aus dem Kanal geschützt werden. Die Hybrid-Hebeanlagen setzen neue Maßstäbe in puncto Ökonomie und Ökologie.
Bodenbelag Minero One – ökologischer, mineralischer Bodenbelag im Großformat - Finalist

Vier Lebenszyklen ohne größeren Rohstoff- und Materialverlust, das verspricht Minero One: ein ökologischer, mineralischer Bodenbelag in naturgetreuen Holz- und Steinoptiken von Minero Flooring. Er besteht zu mehr als 98% aus natürlichen Materialien und kann am Ende des ersten Lebenszyklus aufbereitet und wiederverwendet werden.
RE4 REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction - Gewinner

Im Rahmen des EU geförderten Forschungsprojektes RE4 von ZRS Architekten und weiteren 12 Partnern innerhalb der EU wurde ein detailliertes Design für ein vollständig vorgefertigtes, zirkuläres, energieeffizientes, siebengeschossiges Wohngebäude entwickelt. Eingesetzt werden wiederverwendbare Bauteile oder recyceltes Material. Die Besonderheiten: Das Konzept lässt sich auf andere Gebäudetypologien übertragen. Das Demo-Gebäude in Madrid konnte zu 90 % zerstörungsfrei zurückgebaut werden.
Bestimmung der akustischen Wirksamkeit von Fassadenoberflächen im Stadtraum - Finalist

Wie reagieren Fassaden auf Lärm? Das Forschungsvorhaben der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Frankfurt hat dies getestet. Dabei wurde die Wirkung des akustischen Reflexionsverhaltens von Fassaden im Stadtraum unter realen Bedingungen mit einem mobilen Fassadenlabor analysiert. Die Erkenntnisse dienen dazu, die akustischen Auswirkungen von Fassadenoberflächen in Abhängigkeit des Ortes zu bewerten. Als Entwurfstool dient das hierfür entwickelte Messverfahren für die Planung und Umsetzung leiserer Stadtquartiere.
Robotische Fabrikation von Bauteilen aus Stampflehm - Finalist

Höhere Präzision, erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten und gesteigerte Wirtschaftlichkeit: Dies soll eine robotisch gestützte Fertigung bei der Herstellung von Bauteilen aus Stampflehm ermöglichen. Hiermit befasst sich das mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau geförderte Forschungsprojekt des Instituts für Tragwerksentwurf (ITE) der TU Braunschweig. Ziel ist es, den Herstellungsprozess zu automatisieren und zu verkleinern, um einen wirtschaftlichen und praxistauglichen Prozess für die dezentrale Herstellung von Stampflehm zu generieren.
re.create

Erstmals vergeben wurde ein studentischer Sonderpreis. Diesen erhielt das Projekt re.create von zwölf Studierenden der Technischen Universität München, der Ostbayerischen Technischen Hochschule sowie der International Real Estate Business School Regensburg. Mit ihrem Gebäudeentwurf entwickelten sie eine Vision für ein nachhaltiges, urbanes Leben, das einen sensiblen Umgang mit den Ressourcen voraussetzt.
Gewinner und Finalisten 2019
DAW SE - Gewinner

DAW bietet Lasuren und Holzöle auf Basis von Leindotter an. Die Nutzpflanze wird gemeinsam mit Erbsen im Mischfruchtanbau kultiviert. Dies erhöht nicht nur den Gesamtertrag der Fläche, sondern stärkt auch das Ökosystem sowie die Biodiversität in vielfältiger Weise.
INTEWA GmbH - Finalist

Die dezentrale Systemlösung von INTEWA ermöglicht die Einsparung von Trinkwasser um bis zu 95 Prozent. Mithilfe einer innovativen Membrantechnologie zur Aufbereitung von Regen- und Grauwasser entsteht ein fast geschlossener Wasserkreislauf.
strohlos Produktentwicklung GmbH - Finalist

Die in der Baubranche vielfältig einsetzbaren Platten von strohlos Produktentwicklung bestehen aus einjährig nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Stroh, Hanf, Raps oder Schilf. Alle Platten sind recyclebar, frei von Formaldehyd und wasserbeständig.
Green Hydrogen Esslingen GmbH - Gewinner

Green Hydrogen Esslingen errichtet und betreibt eine Power-to-Gas-Anlage als Herzstück des klimaneutralen Stadtquartiers Esslingen Weststadt. Dabei wird unter anderem grüner Wasserstoff für Mobilität, Industrie und die Rückstromversorgung genutzt.
materialrest24.de - Finalist

Als „virtuelles Lager" für Baumaterial bietet die Online-Plattform materialrest24.de Handwerksunternehmen die Möglichkeit, ihre ungenutzten Lagerbestände digital zu erfassen und bequem zu verkaufen. Gleichzeitig können sie benötigte Baustoffe in der passenden Menge günstig erwerben.
vilisto GmbH - Finalist

Das digitale, selbstlernende Wärmemanagement für Nichtwohngebäude von vilisto erkennt das Nutzungsverhalten und die Gebäudeparameter einzelner Räume für eine vollautomatische, vorausschauende und bedarfsgerechte Steuerung von Heizkörpern.
BauCycle – Innovativer Lösungsansatz für Baustoffrecycling - Gewinner

Das Projekt BauCycle erforscht eine ganzheitliche Verwertungsstrategie für Bauschutt und dessen Feinfraktion. Dabei wurde speziell ein optisches Verfahren zur Sortierung von heterogenem Bauschuttmaterial bis zu einer Korngröße von 1 mm entwickelt. Zudem wurden aus dem Bauschutt hochwertige Produkte hergestellt.
Projektbeteiligte:
- Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP
- Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
- Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT - Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB
Agricultural Lighting Facade - Finalist

Mit der Agricultural Lighting Facade wird ein ganzjähriger Gemüseanbau hinter Glasfassaden in Gebäuden ermöglicht. Integrierbar in neue und bestehende Fassaden sorgt eine optimale Nutzung der Sonneneinstrahlung in Kombination mit einer adaptiven LED-Assimilationsbeleuchtung für die Photosynthese der Pflanzen.
Projektbeteiligte:
- Technische Universität München
- Architecture Research Incubator
- Professur Green Technologies in Landscape Architecture, Prof. Ferdinand Ludwig
- Gewächshauslaborzentrum Dürnast, Forschungseinrichtung des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der TUM
- Lehrstuhl für Raumkunst und Lichtgestaltung, Prof. Hannelore Deubzer
- Ingenieurbüro Hausladen GmbH
- Barthelme LED Solutions
- Projektleitung Mariana Yordanova
Holz-Myzelium basierte Ausbausysteme für den Innenraum - Finalist

In dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde ein modulares, vorkonfektioniertes Material- und Bausystem für den Innenausbau entwickelt. Es besteht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen und nutzt Myzelium als neuartigen, schnellwachsenden Bioverbundwerkstoff.
Projektbeteiligte:
- Arup Deutschland GmbH
- ARDEX GmbH
- MOGU S.r.l.
Gewinner und Finalisten 2018

Das Filtersystem der EXERGENE® Technologie GmbH ermöglicht die Wiederherstellung sowie dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserhygiene ohne Einsatz von Chemie oder thermischer Energie. Die Basis hierfür bildet die Ultrafiltration. Mit Hilfe winziger Poren werden sämtliche ungelösten Inhaltsstoffe rein mechanisch aus dem Wasser entfernt.

In dem Forschungsprojekt wurde eine Methode entwickelt, mittels welcher sich Carbonbetonbauteile recyceln und sortenrein trennen lassen. Ziel war es, alle bei Abbruch-, Rückbau- und Recyclingarbeiten anfallenden Stoffe im Wirtschaftskreislauf zu belassen und im Optimalfall für neue Bauteile zu verwerten.
Gewinner und Finalisten 2017

Das vertikale Gartensystem „Botanic Horizon" der Firmen BOXOM und B+M Textil besteht aus mit Saatgut befüllten Schnüren und einem vertikalen Bewässerungssystem. Neben den vielfältigen Pflanzenkombinationen unterscheidet es sich von einer herkömmlichen Fassadenbegrünung durch die variablen Einsatzmöglichkeiten, eine flexible Anbringung genauso wie eine einfache Demontage.

Das Start-up DACHFARM Berlin entwickelt mit gebäudeintegrierten Dachfarmen unter Glas in Gewächshäusern Lösungsansätze, um das Potenzial ungenutzter Gebäude- und Dachflächen zum professionellen Anbau von Nutzpflanzen und für partizipative Gemeinschaftsgärten nutzbar zu machen. Die Farmen sind sowohl flächen-, als auch ressourcen-, energie- und CO2-effizient.

Die organischen Photovoltaik-Lösungen von OPVIUS aus Nürnberg beruhen auf der Technologie, dass Strom in dünnen Kunststofffolien erzeugt wird, die sich an Gebäuden oder in Produkten verschiedener Art integrieren lassen. Bereits nach wenigen Wochen kann die für die Herstellung der Module aufgebrachte Energie wieder eingespielt werden.
Gewinner und Finalisten 2016

CAALA ist eine cloudbasierte Software zur energetischen Vordimensionierung und parametrischen Lebenszyklusanalyse. Sie gibt planungsintegriert Feedback zu Energiebedarf, Ökobilanz und zur Einhaltung relevanter Richtlinien. Ohne Mehraufwand können so in der frühen Entwurfsphase Varianten erzeugt und verglichen sowie dem Bauherrn visuell kommuniziert werden.

Die Ressource Raum wird in vielen Städten knapp und teuer. Ziel des Forschungsprojektes ist es daher, eine effizientere Nutzung von bereits bestehenden innerstädtischen Flächen durch Mehrfachnutzung zu erreichen. Insbesondere sollen die Potenziale und Umsetzungsmöglichkeiten von Spacesharing aufgezeigt werden, um eine nachhaltige Nutzung der Ressource Raum zu initiieren.






