Wie steht die DGNB zu wichtigen politischen Entscheidungen, energiewirtschaftlichen Entwicklungen oder baulichen Vorgaben? Über unsere Positionspapiere und Stellungnahmen vermitteln wir unsere Haltung, geben Impulse und stoßen Initiativen an.
Positionspapiere und Stellungnahmen zum Download
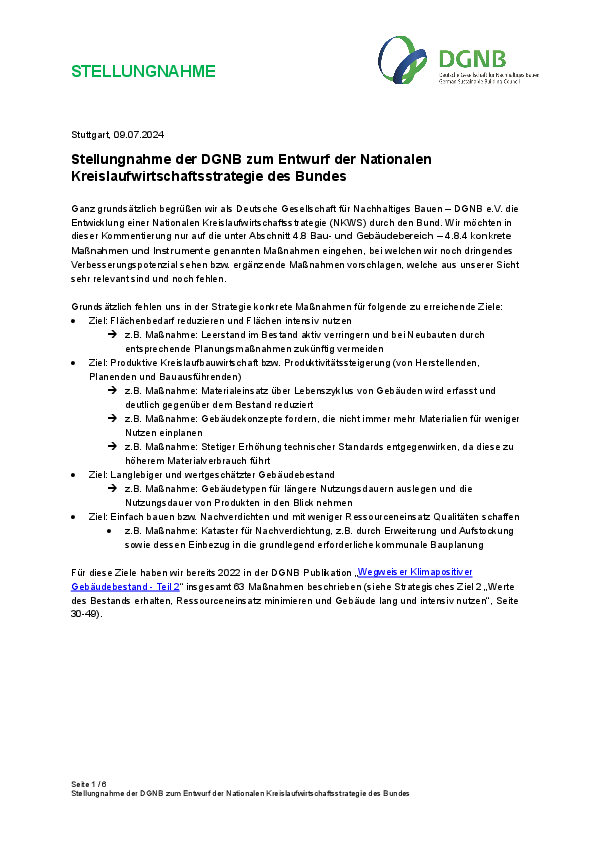
Stellungnahme der DGNB zum Entwurf der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie des Bundes
Am 18. Juni 2024 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) einen Entwurf für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie des Bundes (NKWS) veröffentlicht und die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Ganz grundsätzlich begrüßt die DGNB die Entwicklung durch den Bund. In unserer Kommentierung gehen wir nur auf die unter Abschnitt 4.8 Bau- und Gebäudebereich – 4.8.4 konkrete Maßnahmen und Instrumente genannten Maßnahmen ein, bei welchen wir noch dringendes Verbesserungspotenzial sehen bzw. ergänzende Maßnahmen vorschlagen, welche aus unserer Sicht sehr relevant sind und noch fehlen.
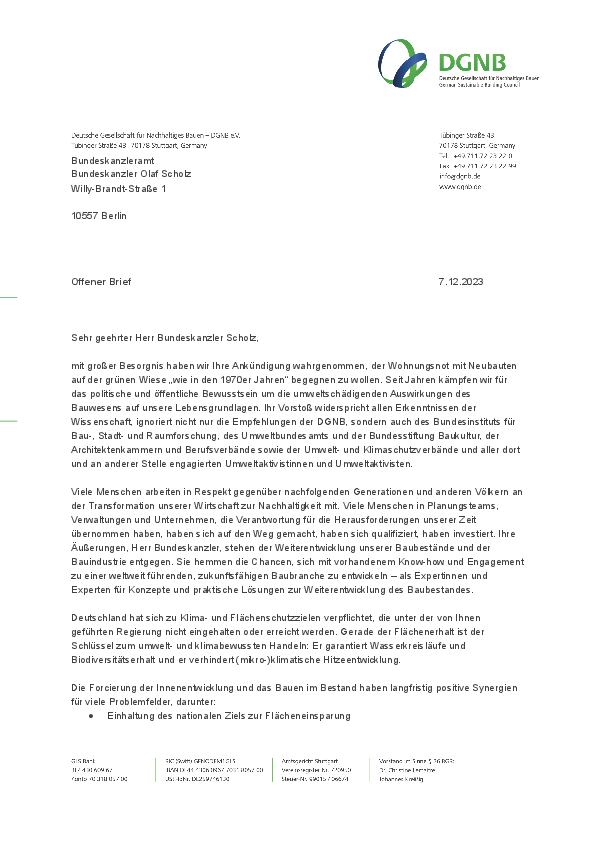
Offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz
Im November 2023 forderte Bundeskanzler Olaf Scholz ein Umdenken beim Bauen. Konkret: den „Bau von 20 neuen Stadtteilen (…) wie in den 70er Jahren“. Die DGNB hat diese Ankündigung mit Besorgnis wahrgenommen. Darüber hinaus hat am 30. November 2023 ein Gerichtsurteil die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung als teilweise rechtswidrig eingestuft. Auf Initiative von Prof. Annette Hillebrandt von der Bergischen-Universität Wuppertal hat die DGNB daher zusammen mit zahlreichen hochrangigen Institutionen und Wissenschaftlern einen offenen Brief an den Bundeskanzler formuliert. In diesem appellieren die Mitzeichnenden eindringlich an den Bundeskanzler, die Äußerungen zu überdenken sowie u.a. für Flächenerhalt und das Bauen im Bestand.

Uns geht die Zeit aus – und warum die BEG-Neubauförderung genau richtig ist | April 2022
Seit Tagen muss man auf allen Kanälen diverse Aufschreie, Ermahnungen und Sorgen rund um die Anpassung der BEG-Förderung von Neubauten ertragen. Die Kritik zur Neuregelung, dass Fördergelder nur noch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-aspekten zu bekommen sind, ist ebenso vielfältig wie die Themen des nachhaltigen Bauens. Die Haltung, mit der dies erfolgt, möchten wir nicht mehr unkommentiert stehen lassen.
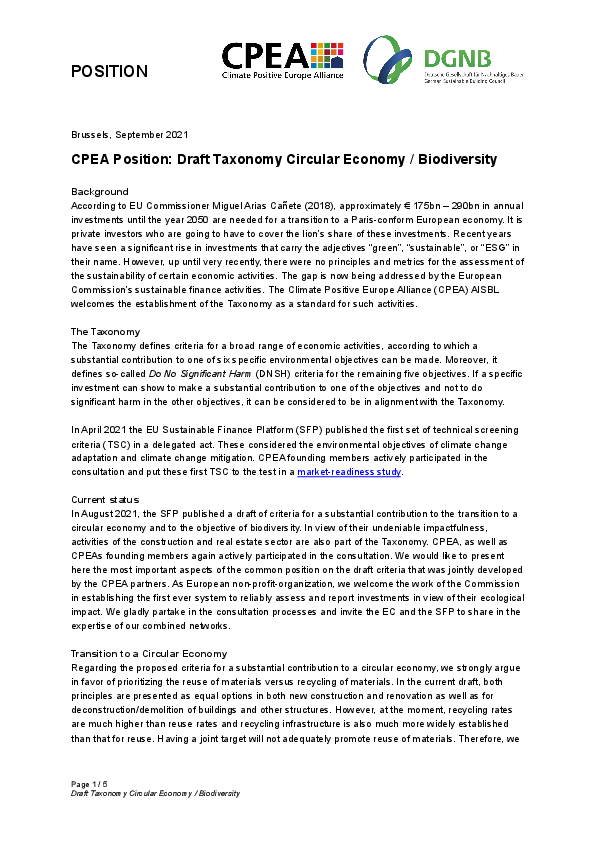
CPEA Position: Draft Taxonomy Circular Economy / Biodiversity | September 2021
Die europäische Sustainable Finance Plattform hat im Rahmen der EU-Taxonomie den ersten Entwurf der Anforderungen für Umweltziele Kreislaufwirtschaft und Biodiversität veröffentlicht. Zusammen mit ihren Partnern der Climate Positive Europe Alliance (CPEA) hat sich die DGNB an der Konsultation beteiligt und eine gemeinsame Position veröffentlicht. Beim Umweltziel „Kreislauf-wirtschaft" wird empfohlen, die wirtschaftlichen Aktivitäten „Neubau" und „Rückbau" nicht getrennt voneinander zu betrachten. Außerdem sollten die Begriffe „reuse" und „recycle" klarer definiert werden. Die Anforderungen des Umweltziels „Biodiversität" sind nach Einschätzung von DGNB und CPEA nicht ambitioniert genug.
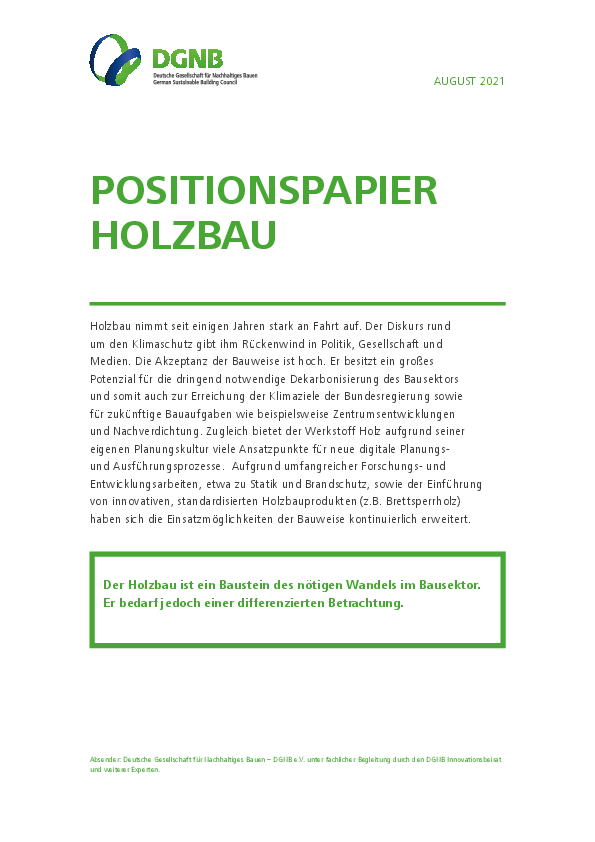
Holzbau erfordert differenzierte Betrachtung | August 2021
Holzbau nimmt seit einigen Jahren stark an Fahrt auf. Der Diskurs rund um den Klimaschutz gibt ihm Rückenwind in Politik, Gesellschaft und Medien. Die Akzeptanz der Bauweise ist hoch. Er besitzt ein großes Potenzial für die dringend notwendige Dekarbonisierung des Bausektors und somit auch zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung sowie für zukünftige Bauaufgaben wie beispielsweise Zentrumsentwicklungen und Nachverdichtung. Zugleich bietet der Werkstoff Holz aufgrund seiner eigenen Planungskultur viele Ansatzpunkte für neue digitale Planungs- und Ausführungsprozesse. Aufgrund umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, etwa zu Statik und Brandschutz, sowie der Einführung von innovativen, standardisierten Holzbauprodukten (z.B. Brettsperrholz) haben sich die Einsatzmöglichkeiten der Bauweise kontinuierlich erweitert.
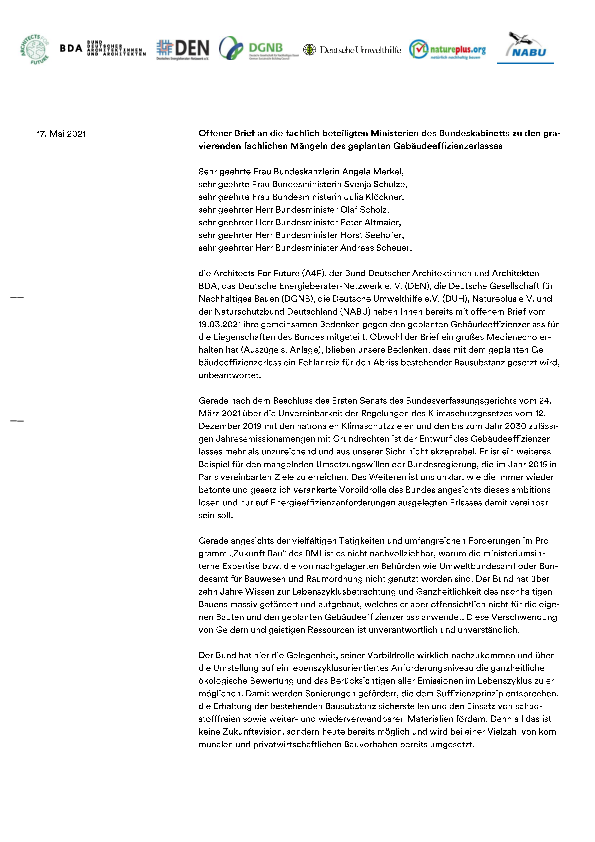
Offener Brief Gebäudeeffizienzerlass | Mai 2021
In einem gemeinsamen Schreiben an verschiedene Ministerien des Bundeskabinetts kritisieren die DGNB und fünf weitere Organisationen den geplanten Gebäudeeffizienzerlass für Liegenschaften des Bundes. Damit setzen sich die Unterzeichner für mehr Klimaschutz und Ressourceneffizienz ein.
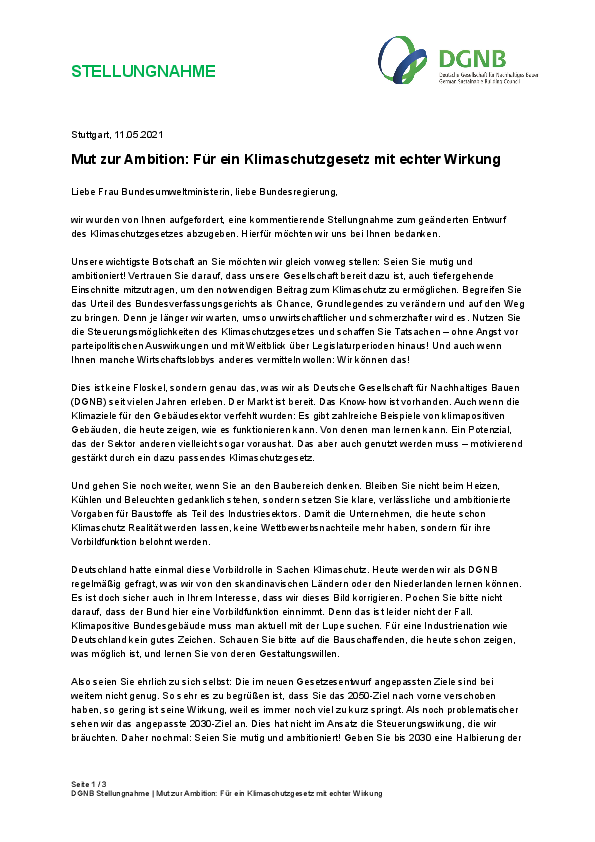
Mut zur Ambition: Für ein Klimaschutzgesetz mit echter Wirkung | Mai 2021
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 ist die Bundesregierung in der Pflicht, ihr Klimaschutzgesetz nachzubessern. Ein neuer Entwurf liegt nun vor. Auf Anfrage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat die DGNB hierzu Stellung genommen.
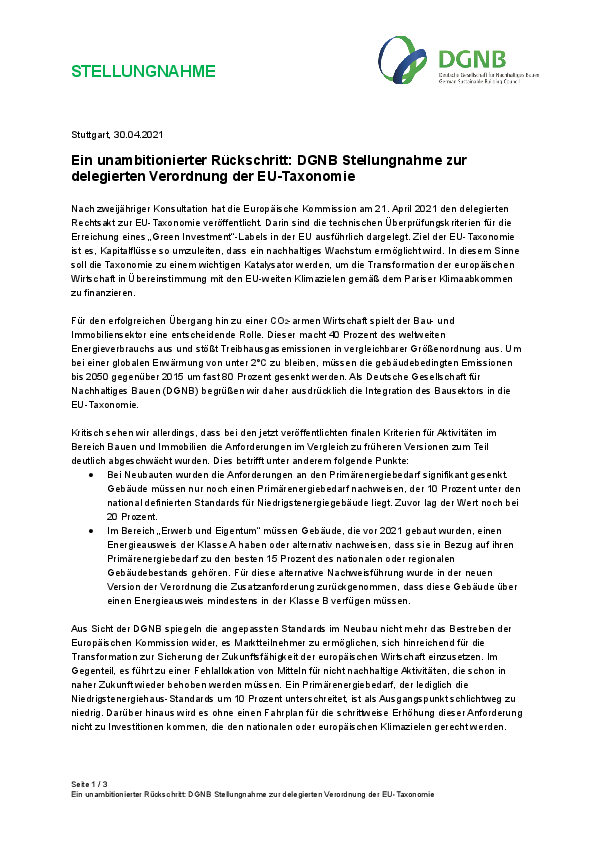
Ein unambitionierter Rückschritt: DGNB Stellungnahme zur delegierten Verordnung der EU-Taxonomie | April 2021
Nach zweijähriger Konsultation hat die Europäische Kommission am 21. April 2021 den delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie veröffentlicht. Darin sind die technischen Überprüfungskriterien für die Erreichung eines „Green Investment"-Labels in der EU ausführlich dargelegt. Für den erfolgreichen Übergang hin zu einer CO2-armen Wirtschaft spielt der Bau- und Immobiliensektor eine entscheidende Rolle. Als DGNB begrüßen wir daher ausdrücklich die Integration des Bausektors in die EU-Taxonomie. Kritisch sehen wir allerdings, dass bei den jetzt veröffentlichten finalen Kriterien für Aktivitäten im Bereich Bauen und Immobilien die Anforde-rungen im Vergleich zu früheren Versionen zum Teil deutlich abgeschwächt wurden.
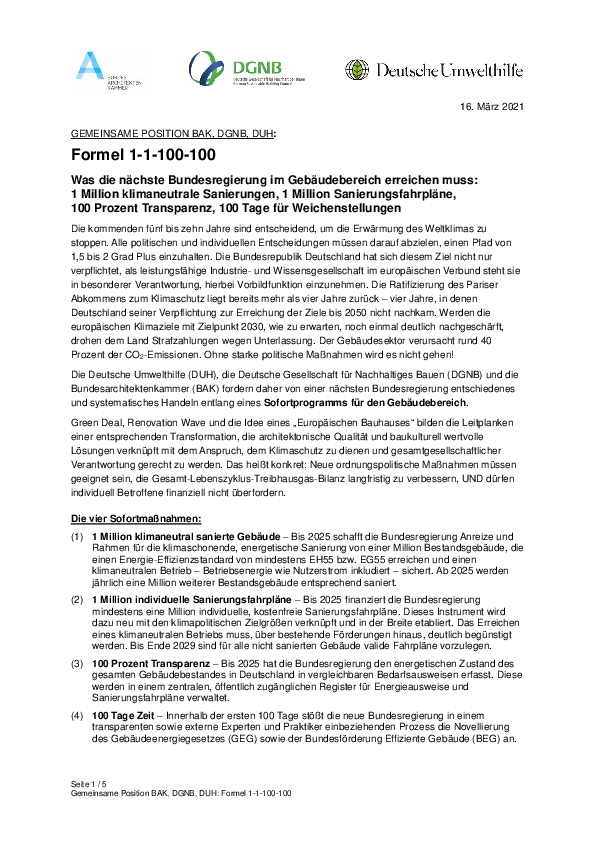
Gemeinsame Position BAK, DGNB, DUH: Formel 1-1-100-100 | März 2021
Was die nächste Bundesregierung im Gebäudebereich erreichen muss: 1 Million klimaneutrale Sanierungen, 1 Million Sanierungsfahrpläne, 100 Prozent Transparenz, 100 Tage für Weichenstellungen.
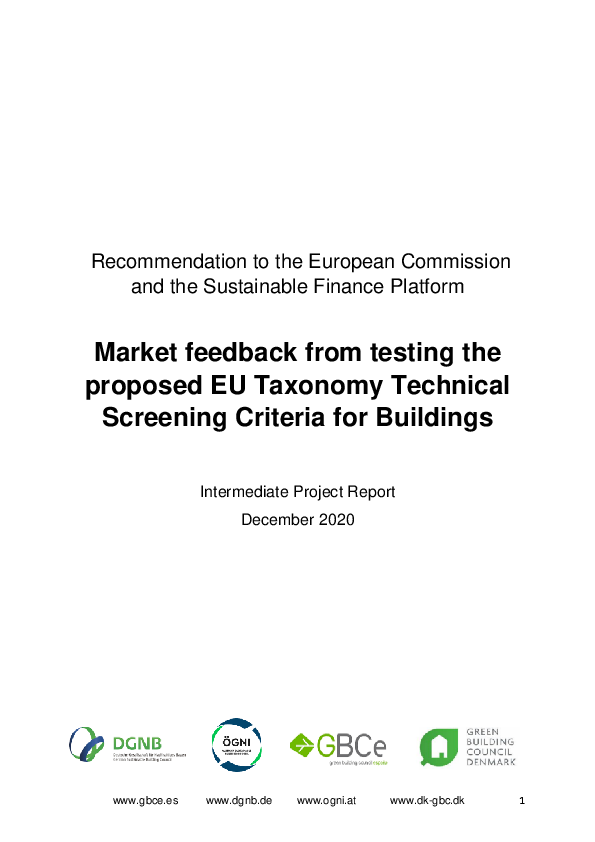
Empfehlung an die Europäische Kommission und die Sustainable Finance Plattform | Dezember 2020
Die DGNB hat mit drei weiteren europäischen GBCs eine Marktstudie zur Anwendung der vorgeschlagenen Taxonomie-Kriterien an realen Gebäuden durchgeführt. Aus dieser Anwendung leiten die Partner an die Europäische Kommission und die Sustainable Finance Plattform für die Anpassung der vorgeschlagenen Kriterien ab. Die Empfehlungen wurden der Europäischen Kommission und der Sustainable Finance Plattform im Rahmen des offiziellen Aufrufs zu Feedback/Konsultation im Dezember 2020 mitgeteilt.
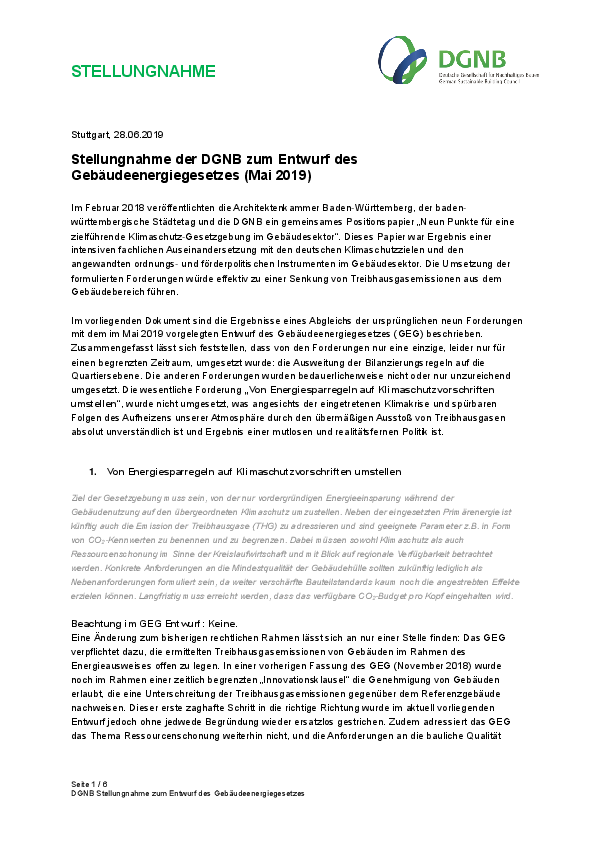
DGNB Stellungnahme zum Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes | Juni 2020
In einer übergeordneten Stellungnahme zum geplanten Gebäudeenergiegesetzt richtet sich die DGNB an die Bundesregierung und die zuständigen Bundesminister. Darin beschreibt die DGNB, warum sie die hinter dem Entwurf stehenden Ziele zwar begrüßt, von der Umsetzung aber enttäuscht ist. Weder wird die Anwendung des Gesetzes merklich vereinfacht, noch setzt das Gesetz wichtige und ambitionierte Impulse und Anreize für klimaschonendes und wahrhaft nachhaltiges Bauen.
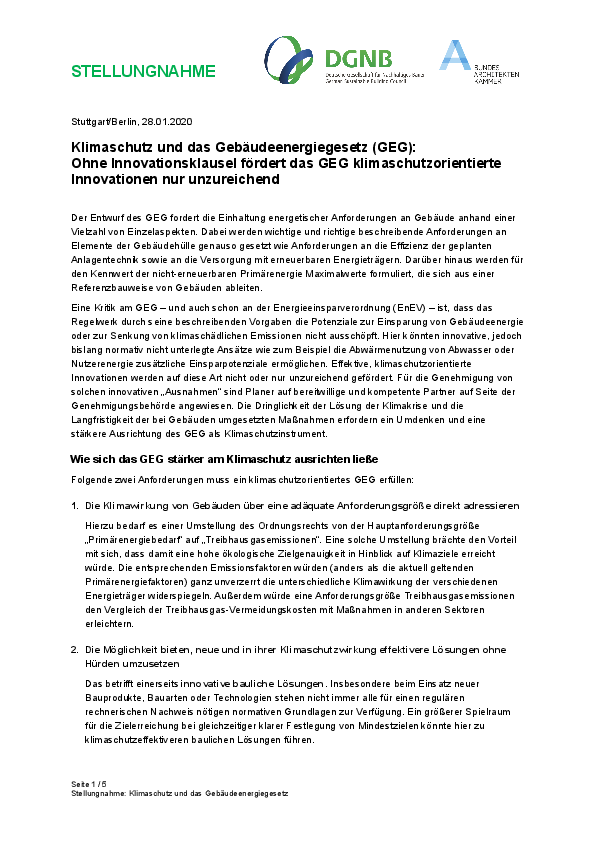
Klimaschutz und das Gebäudeenergiegesetz | GEG): Ohne Innovationsklausel fördert das GEG klimaschutzorientierte Innovationen nur unzureichend | Januar 2020
In einer gemeinsamen Stellungnahme positionieren sich die DGNB und die Bundesarchitektenkammer zum aktuellen Entwurf des GEG (Stand November 2019) und legen dar, wie sich das Regelwerk stärker am Klimaschutz ausrichten ließe. Zudem argumentieren sie, warum die enthaltene Innovationsklausel (§ 103) mit Blick auf den Klimaschutz notwendig ist, und nennen relevante Fakten, um mit entsprechenden Bedenken aufzuräumen.
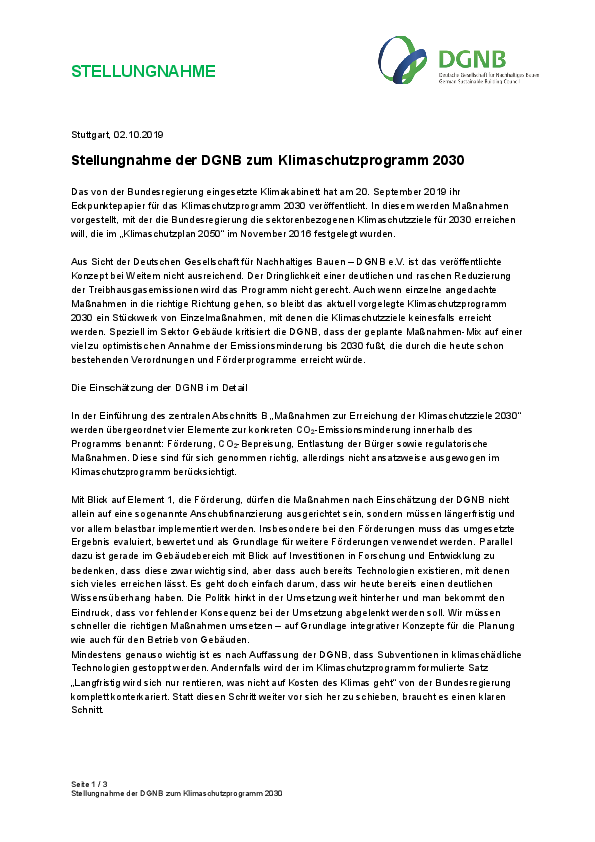
Stellungnahme der DGNB zum Klimaschutzprogramm 2030 | Oktober 2019
Aus Sicht der DGNB ist das veröffentlichte Konzept bei Weitem nicht ausreichend. Der Dringlichkeit einer deutlichen und raschen Reduzierung der Treibhausgasemissionen wird das Programm nicht gerecht. Auch wenn einzelne angedachte Maßnahmen in die richtige Richtung gehen, so bleibt das aktuell vorgelegte Klimaschutzprogramm 2030 ein Stückwerk von Einzelmaßnahmen, mit denen die Klimaschutzziele keinesfalls erreicht werden. Speziell im Sektor Gebäude kritisiert die DGNB, dass der geplante Maßnahmen-Mix auf einer viel zu optimistischen Annahme der Emissionsminderung bis 2030 fußt, die durch die heute schon bestehenden Verordnungen und Förderprogramme erreicht würde.
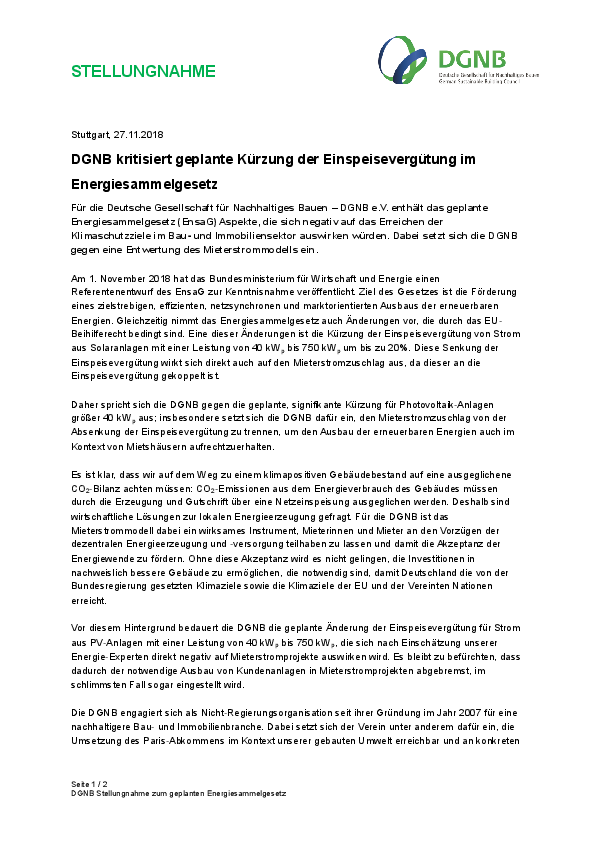
DGNB kritisiert geplante Kürzung der Einspeisevergütung im Energiesammelgesetz | November 2018
Für die DGNB enthält das geplante Energiesammelgesetz (EnsaG) Aspekte, die sich negativ auf das Erreichen der Klimaschutzziele im Bau- und Immobiliensektor auswirken würden. Dabei setzt sich die DGNB gegen eine Entwertung des Mieterstrommodells ein.

Gemeinsame Erklärung zur Qualität von Bewertungssystemen des Nachhaltigen Bauens | Oktober 2018
Die DGNB und das BMI haben eine gemeinsame Erklärung zur Qualität von Bewertungssystemen des nachhaltigen Bauens verfasst. DGNB Präsident Prof. Alexander Rudolphi und Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, haben diese am 9. Oktober im Rahmen der EXPO Real in München unterzeichnet. Mit den in der Erklärung formulierten Grundsätzen einer deutschen Methodik der Nachhaltigkeitsbewertung wollen beide Institutionen für eine ganzheitliche und lebenszyklus-orientierte Planungs- und Baupraxis werben, die einen aktiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leistet. Auch die Form des künftigen Zusammenwirkens von DGNB und BMI ist in dem Dokument definiert.
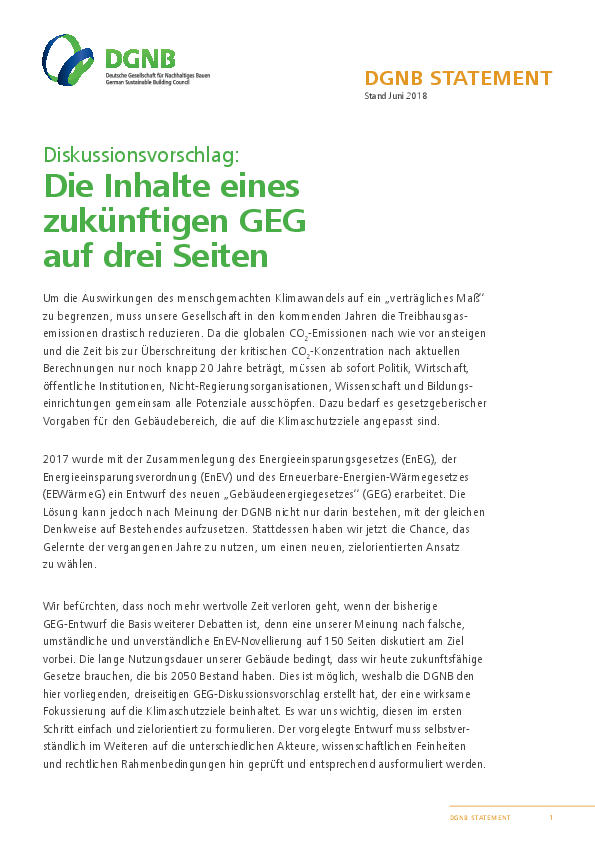
DGNB Diskussionsvorschlag GEG 2050 | Juni 2018
Die Inhalte eines zukünftigen GEG auf drei Seiten Um die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels auf ein „verträgliches Maß" zu begrenzen, muss unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Da die globalen CO2-Emissionen nach wie vor ansteigen und die Zeit bis zur Überschreitung der kritischen CO2-Konzentration nach aktuellen Berechnungen nur noch knapp 20 Jahre beträgt, müssen ab sofort Politik, Wirtschaft, öffentliche Institutionen, Nicht-Regierungsorganisationen, Wissenschaft und Bildungseinrichtungen gemeinsam alle Potenziale ausschöpfen. Dazu bedarf es gesetzgeberischer Vorgaben für den Gebäudebereich, die auf die Klimaschutzziele angepasst sind.

Gemeinsames Positionspapier der Architektenkammer Baden-Württemberg, des baden-württembergischen Städtetags und der DGNB | Februar 2018
Die künftige Regierung muss beim Klimaschutz umdenken. AKBW, DGNB und Städtetag fordern neun Punkte für eine zielführende Gesetzgebung im Gebäudesektor.
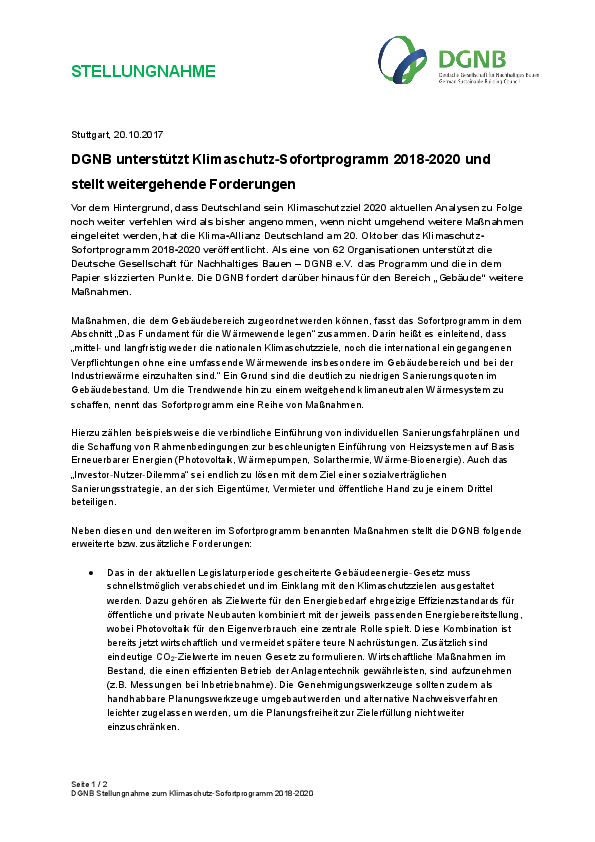
Stellungnahme der DGNB zum Klimaschutz-Sofortprogramm 2018-2020 | Oktober 2017
Vor dem Hintergrund, dass Deutschland sein Klimaschutzziel 2020 aktuellen Analysen zu Folge noch weiter verfehlen wird als bisher angenommen, wenn nicht umgehend weitere Maßnahmen eingeleitet werden, hat die Klima-Allianz Deutschland am 20. Oktober das Klimaschutz-Sofortprogramm 2018-2020 veröffentlicht. Als eine von 62 Organisationen unterstützt die DGNB das Programm und die in dem Papier skizzierten Punkte. Die DGNB fordert darüber hinaus für den Bereich „Gebäude" weitere Maßnahmen.
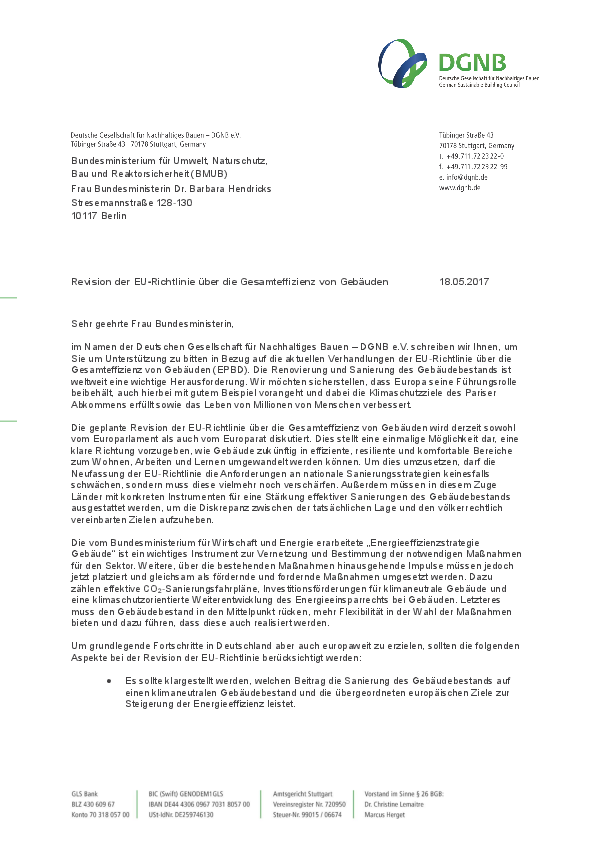
Stellungnahme der DGNB zur Revision der EPBD | Mai 2017
Anlässlich der Verhandlungen des Europarats und Europaparlaments zur EU-Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden (EPBD) hat die DGNB Stellung zu diesem Thema bezogen. In einem Schreiben an verschiedene politische Vertreter legt die DGNB ihre Anforderungen an die Revision dar, die die Bedeutung von Sanierungsstrategien für den Gebäudebestand hervorheben.
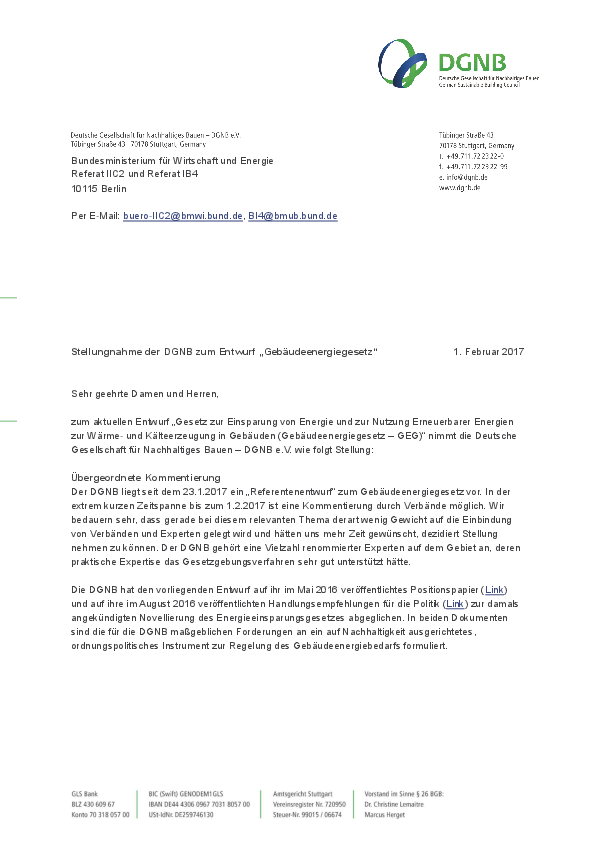
Stellungnahme der DGNB zum Entwurf "Gebäudeenergiegesetz" | Februar 2017
Zum aktuellen Entwurf „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)" hat die DGNB eine umfassende Stellungnahme eingereicht.
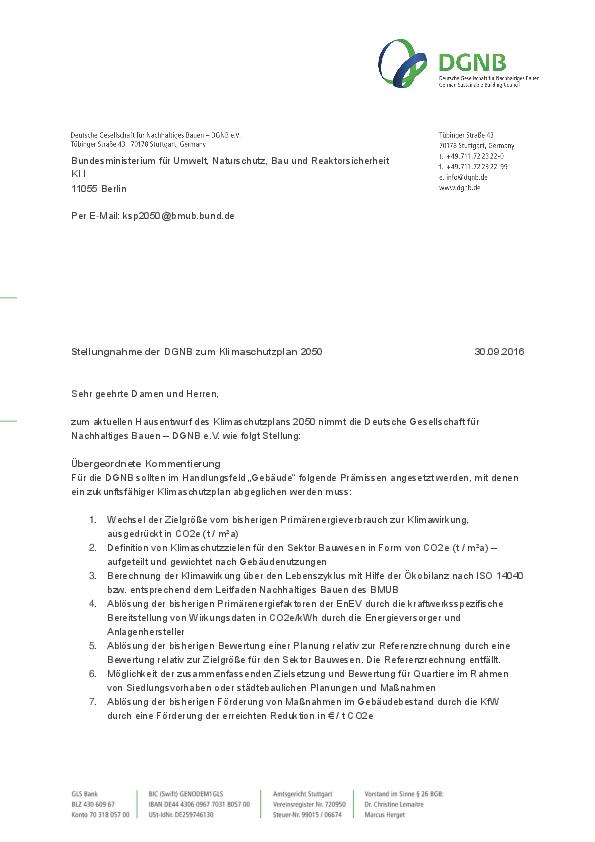
Stellungnahme der DGNB zum Klimaschutzplan 2050 | September 2016
Der Klimaschutzplan 2050 soll die nationalen Empfehlungen und Maßnahmen zum Erreichen der globalen Klimaschutzziele zusammenführen. Die DGNB hat den Hausentwurf der Bundesregierung von September 2016 kommentiert und eine umfassende Stellungnahme eingereicht.
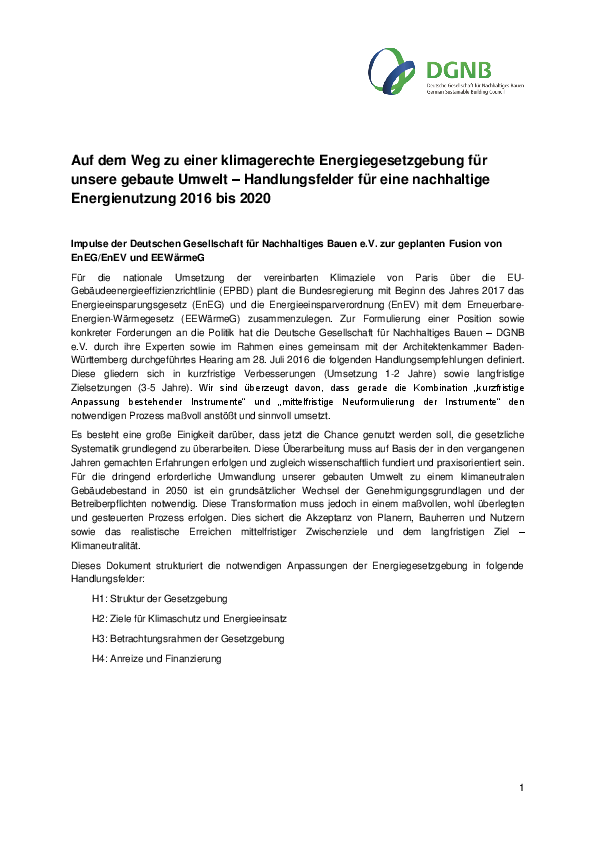
Handlungsfelder für eine nachhaltige Energienutzung 2016 bis 2020 | August 2016
Auf dem Weg zu einer klimagerechten Energiegesetzgebung für unsere gebaute Umwelt – Impulse der DGNB zur geplanten Fusion von EnEG/EnEV und EEWärmeG
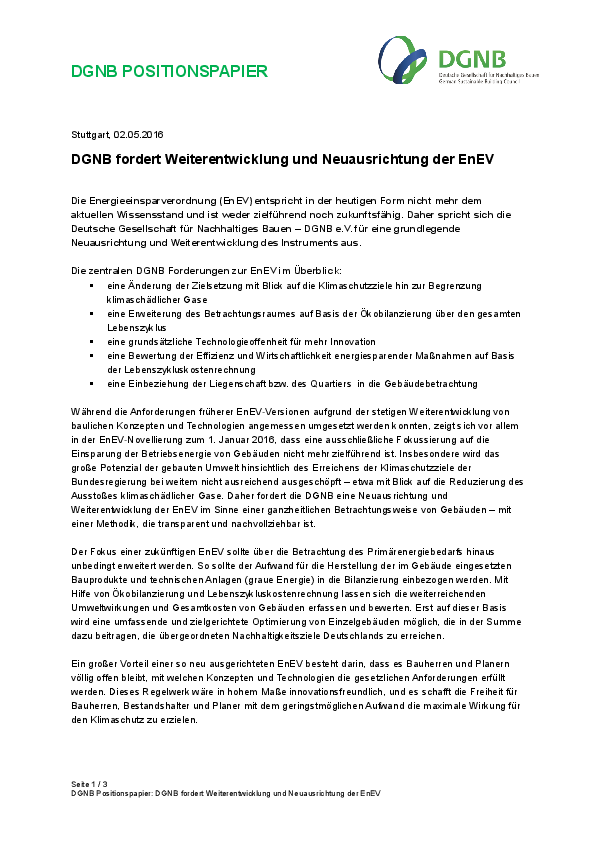
DGNB Positionspapier und Hintergrundinformation zur EnEV | Mai 2016
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht in der heutigen Form nicht mehr dem aktuellen Wissensstand und ist weder zielführend noch zukunftsfähig. Daher spricht sich die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. für eine grundlegende Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Instruments aus.

Politische Forderungen zur Stadtentwicklung: Charta Zukunft Stadt und Grün | Januar 2014
„Grüne Stadtentwicklung in Deutschland - handeln statt reden!" – unter diesem Motto trafen sich am 21.01.2014 die Organisatoren der Initiative Zukunft Stadt und Grün zur Pressenkonferenz in Berlin. Die Initiatoren, der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. und die Stiftung DIE GRÜNE STADT haben gemeinsam mit mehr als 20 Unternehmen – darunter die DGNB – in dem Dokument zentrale Forderungen zur Stadtentwicklung unterzeichnet.
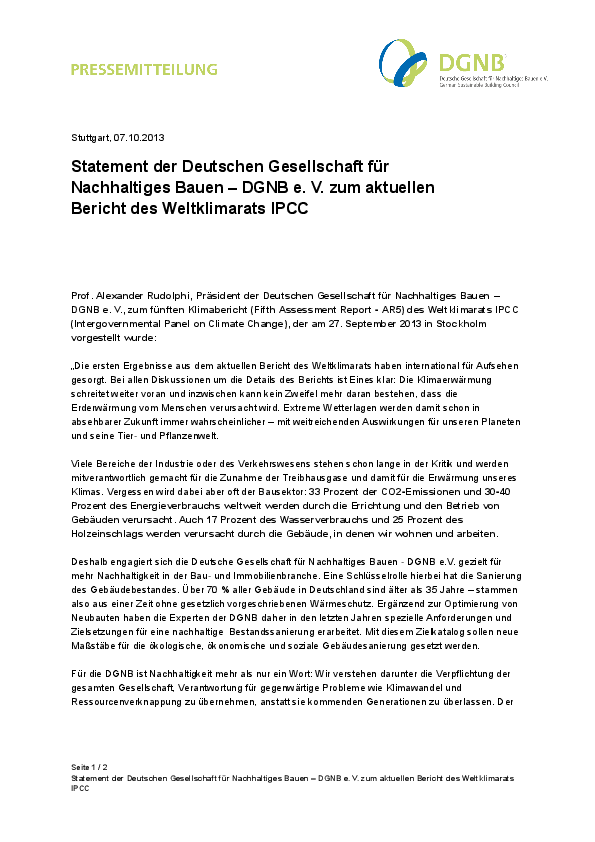
DGNB Statement zum Bericht des Weltklimarats IPCC | Oktober 2013
DGNB Präsident Prof. Alexander Rudolphi zum fünften Klimabericht (Fifth Assessment Report - AR5) des Weltklimarats IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der am 27. September 2013 in Stockholm vorgestellt wurde.
Weitere Publikationen und News
Ihre Ansprechpersonen
Felix Jansen
Abteilungsleiter PR, Kommunikation und Marketing
- Tel.: +49-711-722322-32
- E-Mail: F.JANSEN@DGNB.DE
Christine Schröder
Projektleiterin PR und Medien
- Tel.: +49-711-722322-83
- E-Mail: C.SCHROEDER@DGNB.DE

