Non-Profit, Mitmach-Verein und Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen: Das ist die DGNB

2007 gegründet ist die DGNB heute mit mehr als 2.300 Mitgliedsorganisation das größte Netzwerk seiner Art in Europa, weltweit die Nummer 2. Übergeordnetes Ziel unseres Non-Profit-Vereins ist es, die Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft aktiv zu gestalten, das Verständnis für die Notwendigkeit einer nachhaltigen Bauweise zu fördern und im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu verankern. Wir setzen uns ein für nachweislich gute Gebäude, lebenswerte Quartiere und eine zukunftsfähige gebaute Umwelt.
Kurz erklärt: Das Wichtigste zur DGNB
Lernen Sie unsere Mitglieder kennen: zu den Mitgliedsprofilen
Informiert bleiben, austauschen und Wissen erhalten
Über unsere neue digitale Netzwerkplattform myDGNB können Sie sich aktiv mit anderen im DGNB Netzwerk austauschen. So nutzen zum Beispiel alle unsere Gremien die Plattform, um News zu teilen, Dokumente hochzuladen und Termine zu vereinbaren. Mitglieder und alle in der DGNB qualifizierten Experten erhalten Zugang zu geschützten Bereichen, in denen sie die für sie wichtigsten Dokumente finden. Außerdem gibt es öffentliche Gruppen zu Fachthemen, eine Stellenbörse oder einen Infobereich zu Rabatten speziell für Mitgliedsorganisationen.
In unserem Newsroom finden Sie alle Pressemitteilungen, Hintergrundinformationen, Stellungnahmen und Positionspapiere der DGNB. Außerdem gibt es dort die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Zudem finden Sie hier alle DGNB Newsletter auf einen Blick. Medienvertretende können sich hier für den Presseverteiler anmelden.
In unserem DGNB Blog veröffentlichen wir regelmäßig Beiträge zur Themenvielfalt des nachhaltigen Bauens. Wir stellen DGNB-zertifizierte Projekte vor und kommentieren aktuelle politische oder gesellschaftliche Entwicklungen. Außerdem ordnen wir neue Angebote der DGNB ein und geben Tipps, wie man diese am besten nutzen kann.
Was bedeutet Zertifizieren? Wie funktioniert die BEG-Förderung? Und was muss man für eine nachhaltige Materialwahl beachten? Zu diesen und anderen Themen bieten wir regelmäßig digitale Informationsveranstaltungen an. Diese sind jeweils kostenlos für alle Interessierte offen. Durchstöbern Sie einfach unseren Veranstaltungskalender.
DGNB Zertifizierung: Global Benchmark for Sustainability

Als Planungs- und Optimierungstool zur Bewertung nachhaltiger Gebäude und Quartiere hilft das DGNB System dabei, die reale Nachhaltigkeit in Bauprojekten zu erhöhen. Es fußt auf einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis, das die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen einbezieht. Dabei gibt es eigene Systemvarianten für Neubauten, Sanierungen, Gebäude im Betrieb, Baustellen sowie den Gebäuderückbau. In rund 30 Ländern wurden bereits mehr als 10.000 Projekte von der DGNB ausgezeichnet.
Mehr als Grün: Unser ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz
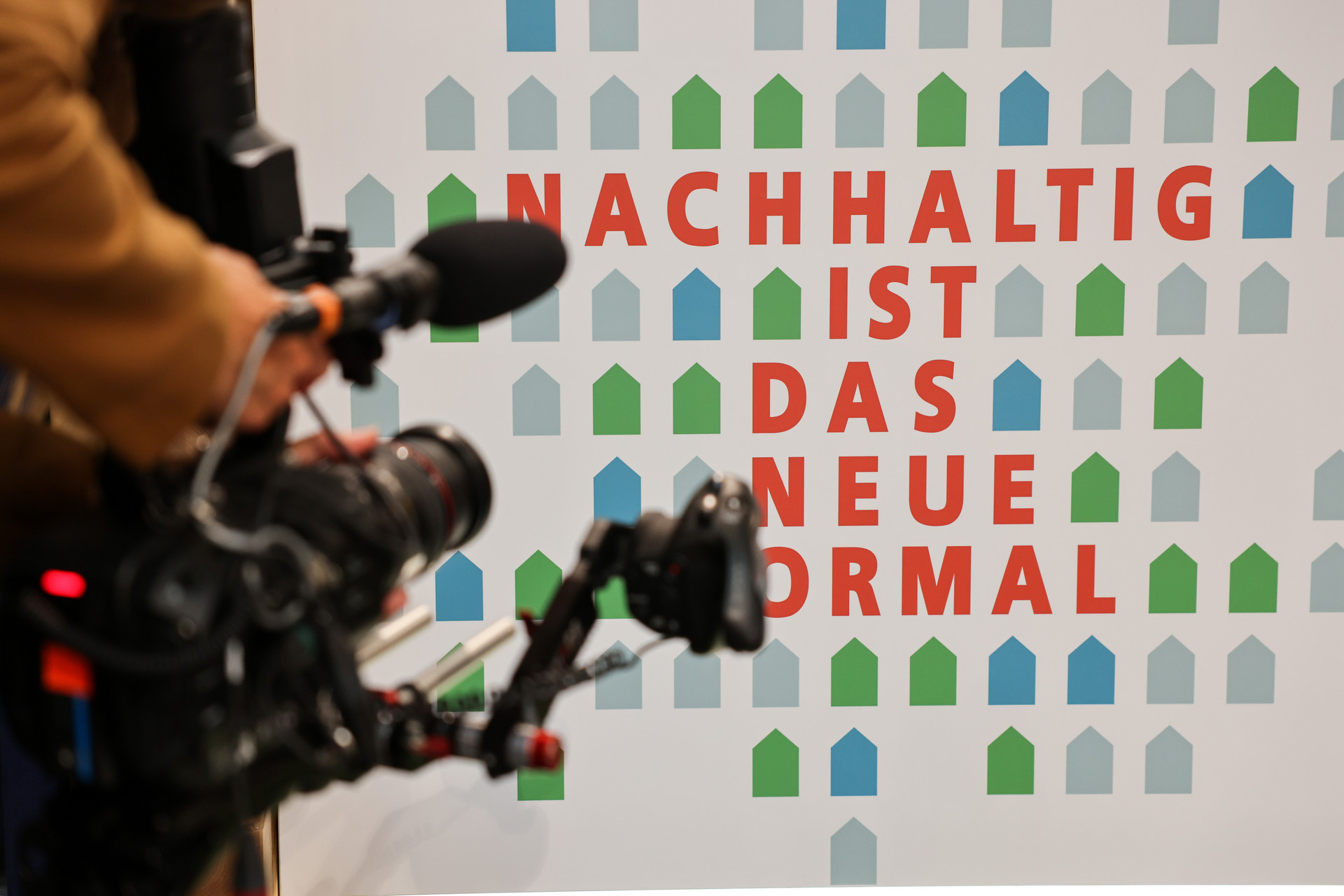
Nachhaltig ist das neue Normal: Dieses Motto hat die DGNB sich bereits im Jahr 2017 zu ihrem zehnjährigen Jubiläum gegeben. Nachhaltiges Bauen bedeutet für uns dabei mehr als Grün. Ganzheitlich und lebenszyklusoritentiert ist der Ansatz, den die DGNB seit jeher verfolgt. Zu verschiedenen Schwerpunktthemen des nachhaltigen Bauens haben wir eigene Toolboxen entwickelt, mit denen Sie kompakte, praktische Einstiegshilfen bekommen.
Wissen, auf das man bauen kann: Mit der DGNB Akademie zum Nachhaltigkeitsexperten werden
Die Qualifikation zum DGNB Auditor ist der höchste Abschluss, den Sie bei der DGNB Akademie erreichen können. Hier bereiten wir Sie darauf vor, das DGNB System von A bis Z in der Praxis anzuwenden. Nach der Ausbildung können Sie uneingeschränkt in allen Märkten tätig sein und Ihre Projekte zur Zertifizierung bei der DGNB einreichen.
Mit der modularen Fortbildung zum DGNB Consultant werden Sie zum akkreditierten Experten für nachhaltiges Planen und Bauen und die DGNB Zertifizierung. Die Ausbildung bereitet Sie darauf vor, die Anforderungen einer DGNB Zertifizierung im Entwurfs-, Planungs- und Bauprozess in der Praxis anzuwenden und optimal umzusetzen.
Die Ausbildung zum DGNB Registered Professional ist Ihr Einstieg als angehender Experte im nachhaltigen Bauen. Hier erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick sozialer, ökologischer und ökonomischer Handlungsmöglichkeiten, um Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche realisieren zu können – aus städtebaulicher Betrachtung bis hin zum einzelnen Gebäude.
Mit der Fortbildung zum DGNB ESG-Manager werden Sie zum akkreditierten Experten für nachhaltiges, ESG-konformes Immobilienmanagement. Sie erhalten die nötigen Kenntnisse, Bestandsgebäude systematisch und ESG-konform zu optimieren und sicher zu managen. Darüber hinaus schulen wir Ihnen umfangreiches Anwendungswissen zum DGNB System für Gebäude im Betrieb und zur Durchführung der ESG-Verifikation zur EU-Taxonomie.

